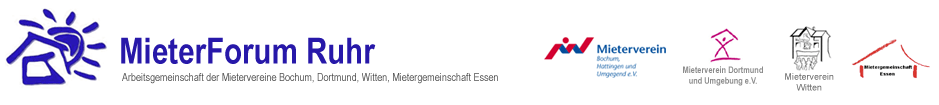

Hattingen: Teuer wohnen im Alter
Theresia Albers könnte man als so etwas wie eine Ortsheilige in Hattingen bezeichnen. 1926 gründete sie im Alter von 54 Jahren die katholische Kongregation der "Schwestern zum Zeugnis der Liebe Christi", die sich um geistig behinderte Kinder und Jugendliche, Arme und Obdachlose kümmerte. Heute führt die Theresia-Albers-Stiftung das Lebenswerk der 1949 verstobenen Ordensfrau fort. Sie betreibt fünf Senioreneinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Essen, seit 2008 auch eine Mietanlage mit 18 behindertengerechten Wohnungen in Hattingen-Zentrum. Nicht alle Mieter dort sind zufrieden.
Die Theresia-Albers-Straße in Hattingen ist so neu, dass sie noch in keinem Stadtplan eingezeichnet ist, und es gibt nur eine Hausnummer in dieser Straße, die 1. Trotzdem kann man die neue Wohnanlage leicht finden, denn sie steht direkt neben dem gut ausgeschilderten Altenheim St. Josef, das auch von der Theresia-Albers-Stiftung betrieben wird. Seid ein paar Wochen sieht das Gelände auch nicht mehr wie eine Baustelle aus.
Das war lange Zeit anders. Als die 24 Mieter - es gibt drei Etagen mit je vier Einzel- und zwei Doppel-Wohnungen - Ende Oktober 2008 einzogen, mussten sie über Matschpisten zum Eingang waten, auf Holzbohlen über Gräben balancieren, Treppen ohne Geländer benutzen, Balkontüren sorgsam verschlossen halten, weil dahinter keine Schutzgitter waren. Erst im Frühsommer wurde der versprochene Aufzug fertig.
Norbert Benkhoff, Mieter im Rollstuhl, erinnert sich: "Wochenlang musste ich von Bauarbeitern getragen werden; dann habe ich denen die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich möchte meine Wohnung jederzeit verlassen und wieder betreten können, habe ich gesagt, sonst zieh ich auf ihre Kosten ins Hotel. Da habe ich dann so einen elektrischen Treppen-Rollstuhl bekommen."
Heute macht die Wohnanlage einen äußerst gediegenen Eindruck, obwohl es sich um Sozialwohnungen handelt. Im Treppenhaus riecht es zwar nach Zahnarzt, aber alles ist nagelneu und blitzeblank; alle Flure sind so breit, dass jederzeit Rollstuhl-Begegnungsverkehr möglich ist; überall sind Balkone, Glastüren, Notausgänge mit beleuchteter Kennzeichnung. Es wirkt luxuriös.
Doch der Teufel liegt im Detail. Und er macht vor allem Mietern, die auf die gepriesene Barrierefreiheit tatsächlich angewiesen sind, das Leben schwer:
- Die zahlreichen Glastüren lassen sich problemlos von innen öffnen, aber von außen nicht wieder verschließen.
- Der Aufzug ist außen angebracht und nur über Holzrampen zu erreichen. Wer zum Briefkasten oder in den Keller will, muss die Treppe nehmen oder wird bei schlechtem Wetter nass.
- Zur Bedienung des Aufzugs braucht man den Wohnungsschlüssel, und der schließt nur die eigene Etage und den Keller auf. Wer einen Nachbarn auf einer anderen Etage besuchen will, muss vorher anrufen und sich am Aufzug abholen lassen.
- An den Türen zu den Rampen gibt es Kanten, die ein Rollstuhlfahrer allein nicht überwinden kann.
- Zwischen dem Treppenhaus und den einzelnen Fluren sind schwere Türen mit Drückern, die man mit Rollator nur rückwärts, im Rollstuhl gar nicht auf bekommt.
Dafür können sich die Gemeinschaftseinrichtungen wirklich sehen lassen. Zu jeder Etage gehört eine große, vollständig ausgestattete Gemeinschaftsküche mit Kühl-Gefrier-Kombi, E-Herd mit Backofen, Spülmaschine, einem Essplatz und Schrank mit allem nötigen Geschirr. Dazu eine Abstellkammer, eine behindertengerechte Toilette, ein riesiges „Wohlfühlbad“ mit Badewanne, Waschbecken und einer weiteren Toilette, und zwei Wohnzimmern, eines davon mit großem Flachbildfernseher. Die Einrichtung der Räume ist durchweg aus Massivholz. Alles wirkt so großzügig, dass man fast übersieht, dass zum Beispiel die Badewanne für Rollstuhlfahrer gar nicht nutzbar ist, weil auf der einen Seite ein Sockel das Heranrollen verhindert, auf der anderen Seite die nahe Toilette.
Krass überdimensioniert
Aber das spielt eigentlich keine Rolle, denn alle diese Gemeinschaftseinrichtungen werden von den Mietern gar nicht gebraucht und folglich auch kaum genutzt. Lediglich im ersten Obergeschoss trifft man sich regelmäßig zum Kaffeetrinken in der Gemeinschaftsküche, in Parterre hat jemand in eines der Wohnzimmer einen Billardtisch gestellt. Eine irgendwie organisierte Gemeinsamkeit wie in den Wohnprojekten aus unserer Serie gibt es nicht.
Kaum genutzt heißt aber leider nicht: kaum bezahlt. Der nachhaltigste Streitpunkt zwischen den Mietern und der Stiftung ist das liebe Geld. Drei mal 110 qm Gemeinschaftsfläche für je acht Personen wollen bezahlt werden, und die Einrichtung müssen die Mieter leasen – ebenso wie die obligatorischen Einbauküchen in den Wohnungen, die zum Beispiel die Eheleute Galka gar nicht gebraucht hätten.
"Als wir uns hier beworben haben, hieß es, die Miete liege bei 4,30 Euro, und die Wohnung hat etwas über 72 qm. Zusammen mit den Nebenkosten sollte es 619 Euro kosten – das konnten wir uns so grade leisten", erzählt Bärbel Galka. "Unsere Küche war erst drei Jahre alt, die sollten wir mitnehmen können. Als wir dann den Mietvertrag unterschrieben, lagen die Kosten schon bei 671 Euro, und jetzt sollen wir noch weitere 90 Euro Leasing-Gebühren für all diese Einrichtungen zahlen, die wir gar nicht brauchen. Davon war vorher nie die Rede!"
Die Wohnungen - nicht zu vergessen - sind Sozialwohnungen, alle Mieter brauchten einen Wohnberechtigungsschein. Paare wie die Galkas und die Benkhoffs dürfen also nicht mehr als 1700 Euro monatlich verdienen. Dieses Missverhältnis macht auch den Ennepe-Ruhr-Kreis, der den Bau mit 1,2 Millionen Euro aus Landesmitteln gefördert hat, und die Stadt Hattingen, die für 20 Jahre ein Belegungsrecht an allen Wohnungen und alle Mieter vermittelt hat, nicht gerade glücklich. Unternehmen können die Behörden allerdings wenig, denn die Grundmiete entspricht der bewilligten Höhe, die Nebenabsprachen sind Zivilrecht. Und die Hohe Menge der Gemeinschaftsflächen entspricht sogar Landesvorschriften für "Gruppenwohnungen", um die es sich hier handelt.
Für Jutta Hüppop, Rechtsanwältin beim Mieterverein, ist die Sache klar: "Im Mietvertrag sind Kosten für das Mobilar zwar erwähnt, aber weder ist diese Formularklausel angekreuzt, noch ist dort ein Betrag eingetragen. Also sind solche Kosten auch nicht vertraglich vereinbart - die Mieter brauchen Sie nicht zu zahlen."
Meinolf Roth, Geschäftsführer der Stiftung, sind die Probleme bekannt, denn er hat eine von 18 Mietern unterschriebene Beschwerde erhalten. Ihn macht die ganze Geschichte sehr unglücklich: „Wir haben den Mietern die Küchen angeboten, und die wollten sie auch haben. Zu keinem Zeitpunkt war davon die Rede, dass die in der Grundmiete enthalten seien. Unsere Mieten sind transpartent kalkuliert und von der Kreisverwaltung genehmigt. Wir verdienen keinen Cent an dem Mobilar. Wir haben hier streng nach Gesetz gebaut, und jetzt sind wir die Bösen!“
Wenn einige Mieter die Küchen nicht mehr haben wollten, sei die Stiftung bereit, sie wieder heraus zu nehmen. Und auch die Gemeinschaftsflächen habe man schließlich moblieren müssen. Man verhandele aber mit dem Bauministerium darüber, die Gemeinschaftsflächen zu reduzieren, denn deren Kosten seien das eigentliche Problem. Meinolf Roth: "Wir sind hier der Reparaturbetrieb für ein Modellprojekt, das nicht funktioniert!"
Kontakt | Sitemap | Datenschutz | Impressum

